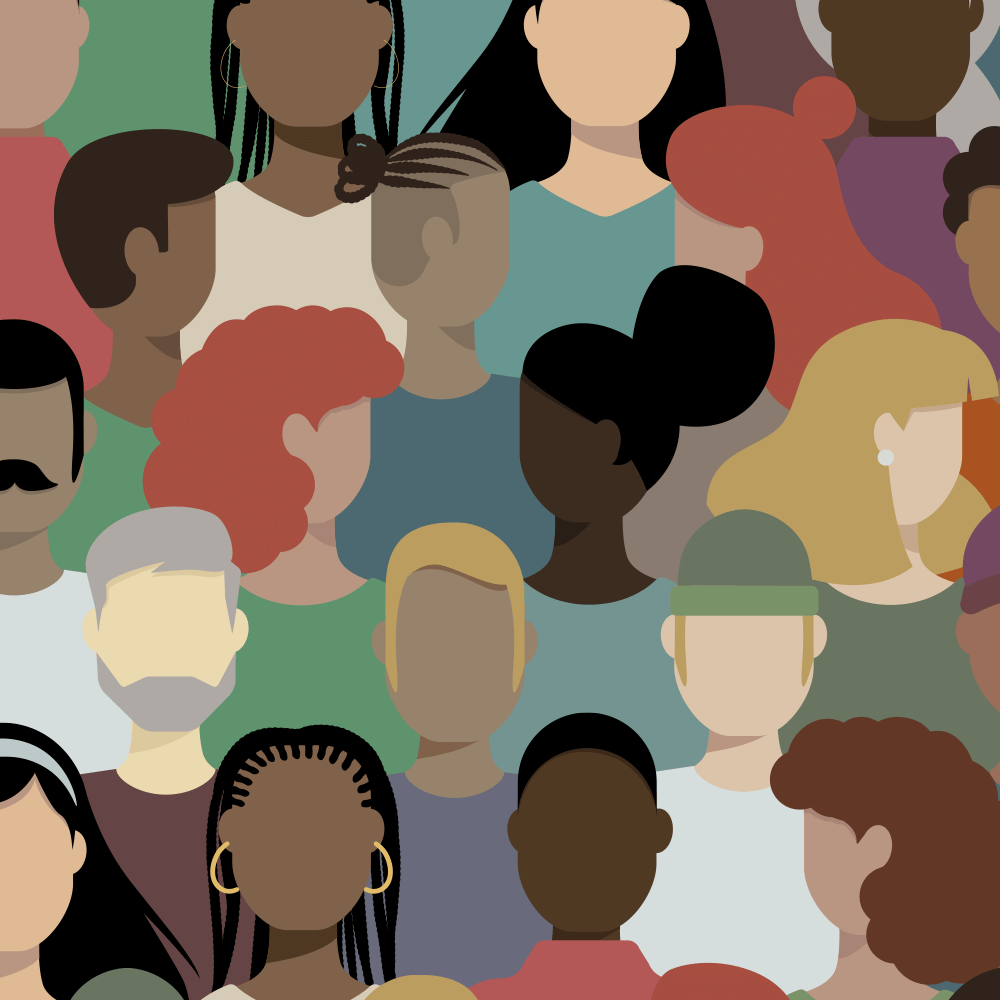
Was ist Rassismus?
Die GRA orientiert sich an zwei grundlegenden Definitionen des Rassismus-Begriffs
1. Definition nach Albert Memmi
Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver biologischer Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.
2. Definition der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz ECRI
a) «Rassismus» bedeutet die Überzeugung, dass ein Beweggrund wie «Rasse», Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft die Missachtung einer Person oder Personengruppe oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Personengruppe rechtfertigt.
b) «Direkte Rassendiskriminierung» bedeutet jede unterschiedliche Behandlung aufgrund von «Rasse», Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationaler oder ethnischer Herkunft ohne sachliche und vernünftige Gründe. Eine unterschiedliche Behandlung ist nichtsachlich und vernünftig begründet, wenn sie kein legitimes Ziel verfolgt oder die Verhältnismässigkeit der angewandten Mittel in Bezug auf das verfolgte Ziel unangemessen ist.
c) «Indirekte Rassendiskriminierung» liegt in Fällen vor, in denen ein scheinbar neutraler Faktor wie eine Regelung, ein Kriterium oder ein Verfahren von Personen, die einer Gruppe angehören, die durch «Rasse», Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft gekennzeichnet ist, nicht einfach erfüllt werden kann oder sie benachteiligt, es sei denn, dieser Faktor ist sachlich und vernünftig begründet. Dies wäre der Fall, wenn ein legitimes Ziel verfolgt wird und wenn die Verhältnismässigkeit der angewandten Mittel in Bezug auf das verfolgte Ziel angemessen ist.
3. Ergänzend können die folgenden Definitionen hilfreich sein
vgl. dazu die Übersicht der Amadeu Antonio Stiftung unter: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/glossar-antisemitismus-und-rassismuskritische-jugendarbeit/
a) Rassismus
Rassismus ist eine Ideologie der Unterdrückung und wurde im Zuge des Kolonialismus und Versklavungshandels hervorgebracht. Er fusst auf einer »Rangordnung« von Menschen, die von biologischen und/oder von Kulturalisierung informierten »Kriterien« unterlegt ist. Rassistische Argumentationen dienen dazu, Machtverhältnisse zu legitimieren. Sie sichern Privilegien der Weissen deutschen Mehrheitsgesellschaft. Rassismus hat verschiedene Formen, wobei Othering (vgl. 3.b)) eine zentrale Rolle spielt. Er wirkt strukturell, institutionell und alltäglich, wird aber häufig verleugnet. Rassismus verhindert die gleichberechtigte Partizipation von People of Color. Jugendarbeit als politischer Bildungsort muss daher die Auseinandersetzung mit Rassismus als konzeptionelle Querschnittsaufgabe begreifen.
b) Othering
Die deutsche Übersetzung klingt ungewohnt, bringt es aber auf den Punkt: »Othering« heisst, jemanden »andern«, zum:zur Anderen machen. Genau das passiert, wenn »Wir« uns von den vermeintlich »Anderen« abgrenzen. Diese Unterscheidung fusst auf hierarchischem und stereotypem Denken. Während die eigene »Normalität« bestätigt und aufgewertet wird, erscheinen die »Anderen« als weniger tolerant, demokratisch oder gebildet. Othering gibt es auch in Bildungseinrichtungen, etwa wenn bestimmte Jugendliche als Expert:innen »ihrer« Kultur oder Religion befragt werden, obwohl ihre Lebenswelt damit nichts zu tun haben muss. Es erzeugt Ausgrenzung und reproduziert Vorurteile und Klischees. Demgegenüber werden Jugendliche durch Empowerment ermutigt, ihre eigenen Sichtweisen zu äussern und zu vertreten.
© GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, 2015/2020.

Lesung und Gespräch zu «Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen.»
Am 8. Mai 2025 sprechen Judith Coffey und Vivien Laumann im Zollhaus Zürich über ihr Buch «Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen».
Im Buch loten die Autorinnen das Verhältnis von Jüdischsein und weiss-Sein aus und gehen der spezifischen Unsichtbarkeit von Juden:Jüdinnen in der Mehrheitsgesellschaft nach. In Anlehnung an das Konzept der Heteronormativität erlaubt «Gojnormativität», Dominanzverhältnisse in der Gesellschaft zu befragen und so ein anderes Sprechen über Antisemitismus zu etablieren.
Das Buch ist eine Aufforderung zu einem bedingungslosen Einbeziehen von Juden:Jüdinnen in intersektionale Diskurse und Politiken und zugleich ein engagiertes Plädoyer für solidarische Bündnisse und Allianzen.
Wann: 8. Mai 2025 um 19:00 Uhr
Wo: Zollhaus Zürich / online mit Livestream
Sprache: Deutsch und Verdolmetschung in Gebärdensprache (auf Anfrage)
Moderation: Prof. Dr. Amir Dziri
In Kooperation mit: ZIID und feministisch*komplex
>>Tickets kaufen: ZIID Zürcher Institut für interreligiösen Dialog
>>Flyer herunterladen
