Neues der GRA

Rassismusbericht 2022
Analyse und Erläuterung zu Diskriminierungsfällen in der Schweiz
Der neuste Bericht der GRA und GMS ist da.
Besorgniserregend ist die Tatsache, dass die rechtsextremen Aufmärsche stark zugenommen haben. Auffällig ist auch der grosse Anteil verbaler Rassismusvorfälle im öffentlichen Raum. Struktureller und institutioneller Rassismus tritt besonders häufig auf, wie die Analyse der direkten Meldungen von Betroffenen an die Stiftungen zeigt.
Ein weiteres Thema, das letztes Jahr die Schweizer Medien dominierte und zu hitzigen und wenig konstruktiven Debatten führte, war die sogenannte kulturelle Aneignung. Zur Diskussion über linke Identitätspolitik haben wir Hintergrundinterviews mit der Kulturwissenschaftlerin Yebooa Ofosu und dem Politikwissenschaftler Oliver Strijbis geführt.

Parlamentarische Gruppe gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit trifft sich in Bern
Parlamentarische Gruppe gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit trifft sich in Bern
Seit der Gründung der parlamentarischen Gruppe gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist die GRA Stiftung für die Leitung des Sekretariats verantwortlich. Am 1. März 2023 wurde ein Event für alle Ratsmitglieder organisiert, die sich eingehend mit dem „Verbot von rassistischen Symbolen im öffentlichen Raum“ auseinandersetzen wollten.
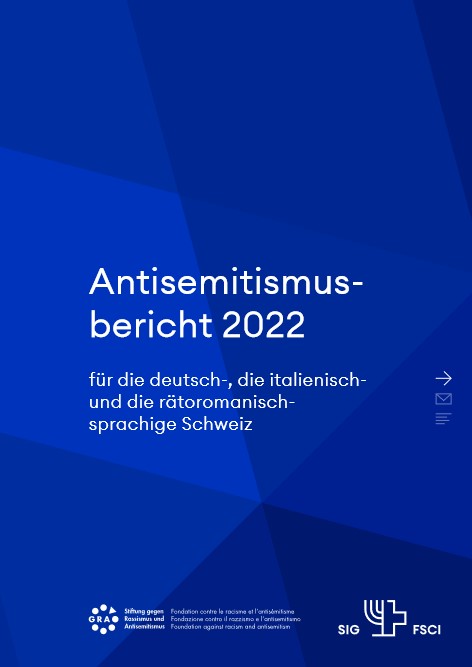
Antisemitismusbericht 2022
Antisemitismusbericht 2022
Der Antisemitismusbericht des Schweizerischen Israelitischen Gemeindesbundes SIG und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA wurde am 28. Februar veröffentlicht. Eine kurze Zusammenfassung finden Sie in unserem Bericht „Rassismus in der Schweiz 2022“.
Den ganzen Antisemitismusbericht finden Sie hier.
GRA Glossar Begriffserweiterung
GRA Glossar Begriffserweiterung
In der Sensibilisierungsarbeit betont die GRA immer wieder die Wichtigkeit von Sprache und Sprachgebrauch. Das seit vielen Jahren etablierte GRA Glossar dient dabei als wichtiges Tool, um die Hintergründe von diskriminierenden und vermeintlich diskriminierenden Begriffen zu erklären.
Im Jahr 2022 wurde das Glossar von mehr als 120’000 User:innen aufgerufen. Die Einträge «N»-Wort, «Arbeit macht frei» und «SA und SS» verzeichneten die meisten Besucher:innen, die sich über die Hintergründe dieser Ausdrücke informieren wollten.
Im Jahr 2022 wurden unter anderem folgende Begriffe hinzugefügt: Blackfacing, Kulturelle Aneignung und LGBTIAQ+.
GRA-Stiftung fordert weiterhin: Die Schweiz braucht ein nationales Verbot von Symbolen im öffentlichen Raum, die für menschenverachtende Ideologien stehen
GRA-Stiftung fordert weiterhin: Die Schweiz braucht ein nationales Verbot von Symbolen im öffentlichen Raum, die für menschenverachtende Ideologien stehen
Im heute veröffentlichten Bericht des Bundesamtes für Justiz zur Rechtslage in Zusammenhang mit einem potenziellen Verbot nationalsozialistischer, rassendiskriminierender, gewaltverherrlichender und extremistischer Symbole werden verschiedene Varianten zur Einführung einer entsprechenden Norm detailliert aufgeführt.
Der Bericht hält zwar fest, dass die bestehende Gesetzeslage für die meisten Situationen ein ausreichendes Instrumentarium bietet, aber eben nicht für alle. Denn gemäss geltendem Recht bleibt straflos, wer mit einem menschenverachtenden Symbol «nur» die eigene Meinung äussert, nicht aber beabsichtigt, andere damit zu beeinflussen oder für eine bestimmte Ideologie zu werben. Die Gerichte müssen also entscheiden, wie sich beispielsweise passives Zurschaustellen von Nazisymbolen von aktivem Werben für den Nationalsozialismus unterscheidet. Diese Praxis ist nicht nur schwer nachvollziehbar, sondern auch kaum praktikabel und führt zufolge der objektiv schwierigen Unterscheidung zwischen passivem Zurschaustellen und aktivem Werben zu Rechtsunsicherheit. Aus diesem Grund ist eine Gesetzesänderung auf nationaler Ebene notwendig, welche Klarheit schafft und Rechtssicherheit gewährt. Die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus spricht sich deshalb dezidiert für eine Erweiterung von Artikel 261bis StGB aus, wie sie im heutigen Bericht des Bundesamtes für Justiz ausdrücklich als mögliche Handlungsvariante aufgeführt wird.

Human Rights Filmfestival
Human Rights Filmfestival
Im Dezember 2022 fand zum achten Mal das Human Rights Film Festival in Zürich statt. Die Robert F. Kennedy Schweiz Stiftung lud Schulklassen zum gesponserten Animationsfilm „Wo ist Anne Frank?“ von Ari Folman mit anschliessender Podiumsdiskussion ein. Über 300 Schüler:innen besuchten den Film und nahmen rege an der Diskussion teil. Es wurde über den 2. Weltkrieg reflektiert und über Diskriminierung und Rassismus in der heutigen Zeit diskutiert. Claudia Solanes von der RFK Schweiz moderierte die Diskussion mit den Schüler:innen sowie den Expertinnen GRA-Geschäftsleiterin Stephanie Graetz und Giulia Reimann der EKR.

Neue GRA-Geschäftsleiterin
Am 1. Juli gab es bei der GRA einen Wechsel in der Geschäftsleitung. Stephanie Graetz hat Dina Wyler abgelöst.
Der Stiftungsrat freut sich sehr, mit Stephanie Graetz eine vielseitige Persönlichkeit mit langjähriger beruflicher Erfahrung im Medien- und Kommunikationsbereich als neue Geschäftsleiterin für die GRA gewonnen zu haben. Neben der Projektarbeit sind Öffentlichkeitsarbeit und (politische) Kommunikation für die GRA im aktuellen Umfeld von zentraler Bedeutung und der Stiftungsrat ist davon überzeugt, dass es Stephanie Graetz aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung gelingen wird, den wichtigen Anliegen der GRA schweizweit das nötige Gehör zu verschaffen.

Podcast: SRF-Moderatorin Angélique Beldner redet Klartext
Erwartungen an sich selbst und Hoffnungen in die Anderen. So beschreibt Angélique Beldner ihre persönliche Herangehensweise beim Thema Rassismus. Die erste Schwarze News-Moderatorin der Schweiz hat im Herbst 2020 einen berührenden Dokumentarfilm für das Schweizer Fernsehen gedreht, in welchem sie von ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung berichtet. Im Podcast erzählt sie, wie es zu diesem Film gekommen ist, was sie heute anders machen würde und wieso die Frage wer über Rassismus sprechen darf und soll nicht zielführend ist.
SRF: Der Sommer in dem ich Schwarz wurde.
Buch: Der Sommer in dem ich Schwarz wurde (Angelique Beldner und Martin R. Dean).

Rassismus im Schulalltag
Wie reagiere ich auf diskriminierende Sprüche des Schulkameraden? Wie erkläre ich einer Lehrperson, weshalb ein bestimmter Begriff problematisch ist? Und was kann ich ganz konkret tun, wenn es zu einem rassistischen Vorfall im (Schul-)Alltag kommt? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des zweitägigen Workshops „Sparks – Zämä gege Rassismus“, welchen die GRA anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus für Schüler:innen und ihre Lehrpersonen in Zürich durchführte.
In dem Workshop erkundeten Lernende interaktiv in verschiedenen Übungen und Diskussionsrunden die Themen Rassismus und Antisemitismus und lernten, wie sie die Themen im (Schul-)Alltag erkennen und diesen lösungsorientiert begegnen können. Auch Lehrpersonen erhielten Möglichkeit sich untereinander und mit den anwesenden Expert:innen zu den Themen Rassismus und Antisemitismus auszutauschen und an einem speziell für sie konzipierten Workshop teilzunehmen.
Das durchweg positive Feedback der Teilnehmenden und das Interesse der Medien an dem Workshop der GRA zeigen, wie aktuell und wichtig die Auseinandersetzung mit diesem Themen besonders an Schulen ist.
Mehr Informationen zum Workshop finden Sie hier: Sparks – Zämä gege Rassismus | GRA – Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus
Medienberichte zum Workshop finden Sie hier:
18-jährige Schüler:innen über Rassismus-Erfahrungen (watson.ch)
Der Workshop „Sparks – Zämä gege Rassismus“ wird unterstützt durch die Fachstelle Rassismusbekämpfung des Bundes.

„Ein Zeichen gegen menschenverachtende Ideologien“
Herr Jositsch, Ende 2021 wurden gleich drei politische Vorstösse eingereicht, die ein Verbot von extremistischen oder nationalsozialistischen Symbolen fordern. Wie deuten Sie diese Entwicklung?
Parlamentarier:innen sind ein Sensor für den Zeitgeist und greifen jene Themen auf, die die Gesellschaft bewegen. Die Proteste gegen die Coronamassnahmen haben rechte Gruppierungen auf den Plan gerufen, die an Protesten mitlaufen. Gleichzeitig häufen sich bei diesen Protesten Vergleiche mit dem Nationalsozialismus, beispielsweise mit dem gelben Davidstern. Teile der Gesellschaft fordern daher ein klares Zeichen der Politik, welches mit diesen Vorstössen aufgegriffen wurde.
Ein Verbot nationalsozialistischer Symbole wird immer wieder diskutiert im Parlament. Vor 15 Jahren haben Sie sich ebenfalls für ein Verbot ausgesprochen, als dieses als Bundesratsvorlage in die Vernehmlassung ging. Am Schluss wurde das Thema aber versenkt. Wieso?
Dazu muss man die Entstehungsgeschichte der Rassismus-Strafnorm verstehen. Als diese Mitte der 90er Jahre dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wurde, sahen bestimmte Kreise die Meinungsäusserungsfreiheit in Gefahr. Man entschied sich aus strategischen Gründen dazu, die Norm eher «schlank» zu halten, damit die Chancen einer Annahme an der Urne möglichst hoch sind. Schon damals erwog man aber eine mögliche Ergänzung für Symbole in Zukunft. Heute ist die Rassismus- Strafnorm weniger umstritten – eine Ergänzung daher vielleicht gar nicht so unrealistisch.
Wäre ein Verbot überhaupt umsetzbar?
Ich glaube in dieser Debatte ist es wichtig, dass man eine realistische Erwartungshaltung beibehält. Allein die Tatsache, dass solche Symbole konstant in leicht abgeänderter Form neu in Erscheinung treten, macht die Umsetzung eines Verbotes unglaublich schwierig. Die Erwartung, dass man bei einem Verbot solche Symbole nicht mehr sieht im öffentlichen Raum, ist unrealistisch. Wenn es aber vor allem darum geht, ein Zeichen zu setzen, dass menschenverachtende Ideologien nicht geduldet werden im öffentlichen Raum, dann kann ein Verbot durchaus Sinn ergeben. Schliesslich ist Geldwäscherei ja auch verboten, auch wenn diese damit nicht verhindert werden kann.
Wenn ein Gesetz allein nicht reicht, was braucht es zusätzlich zur Bekämpfung der Verbreitung und Anziehungskraft solcher Symbole?
Das beste und wohl nachhaltigste Mittel ist Präventions- und Bildungsarbeit. Die junge Generation muss genau wissen, wofür diese Symbole stehen und weshalb sie auf keinen Fall verharmlost oder für die eigene politische Agenda eingesetzt werden dürfen. Dieses Wissen muss so vermittelt werden, damit es die Lebensrealität junger Generationen auch anspricht.
Zur Person:
Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch ist Ständerat und Professor für Aktuelle Vorstösse zum Verbot von Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich. Er ist zudem Mitglied der Staatspolitischen Kommission, Mitglied der Delegation bei der Interparlamentarischen Union und seit 2018 Vizepräsident der Sozialdemokratischen Fraktion.
Aktuelle Vorstösse zum Verbot von rassistischen Symbolen im Parlament:
Die von Marianne Binder-Keller eingereichte Motion «Keine Verherrlichung des Dritten Reiches – Nazisymbolik im öffentlichen Raum ausnahmslos verbieten» zielt darauf ab, eine eigenständige Grundlage zu schaffen, um die Verwendung von in der Öffentlichkeit bekannten Kennzeichen des Nationalsozialismus digital wie in der realen Welt zu verbieten und unter Strafe zu stellen
Mit der Parlamentarischen Initiative «Verbot der öffentlichen Verwendung von extremistischen, gewaltverherrlichenden und rassistischen Symbolen», eingereicht von Angelo Barrile, soll eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen erreicht werden, um die öffentliche Verwendung von Propagandamitteln, insbesondere des
Nationalsozialismus oder einer rassistisch motivierten Vereinigung unter Strafe zu stellen.
Die Parlamentarische Initiative «Öffentliche Verwendung und Verbreitung rassendiskriminierender Symbole in jedem Fall unter Strafe stellen», eingereicht von Gabriela Suter, zielt darauf ab, das Strafgesetzbuch dahingehend zu ergänzen, dass die öffentliche Verwendung oder Verbreitung von rassistischen Symbolen, nationalsozialistischen Symbolen im Besonderen, mit Busse bestraft werden, auch wenn diese ohne Werbecharakter präsentiert werden. Eine Ausnahme soll hier für die öffentliche Verwendung oder Verbreitung solcher Symbole zu wissenschaftlichen oder
schutzwürdigen kulturellen Zwecken gelten.
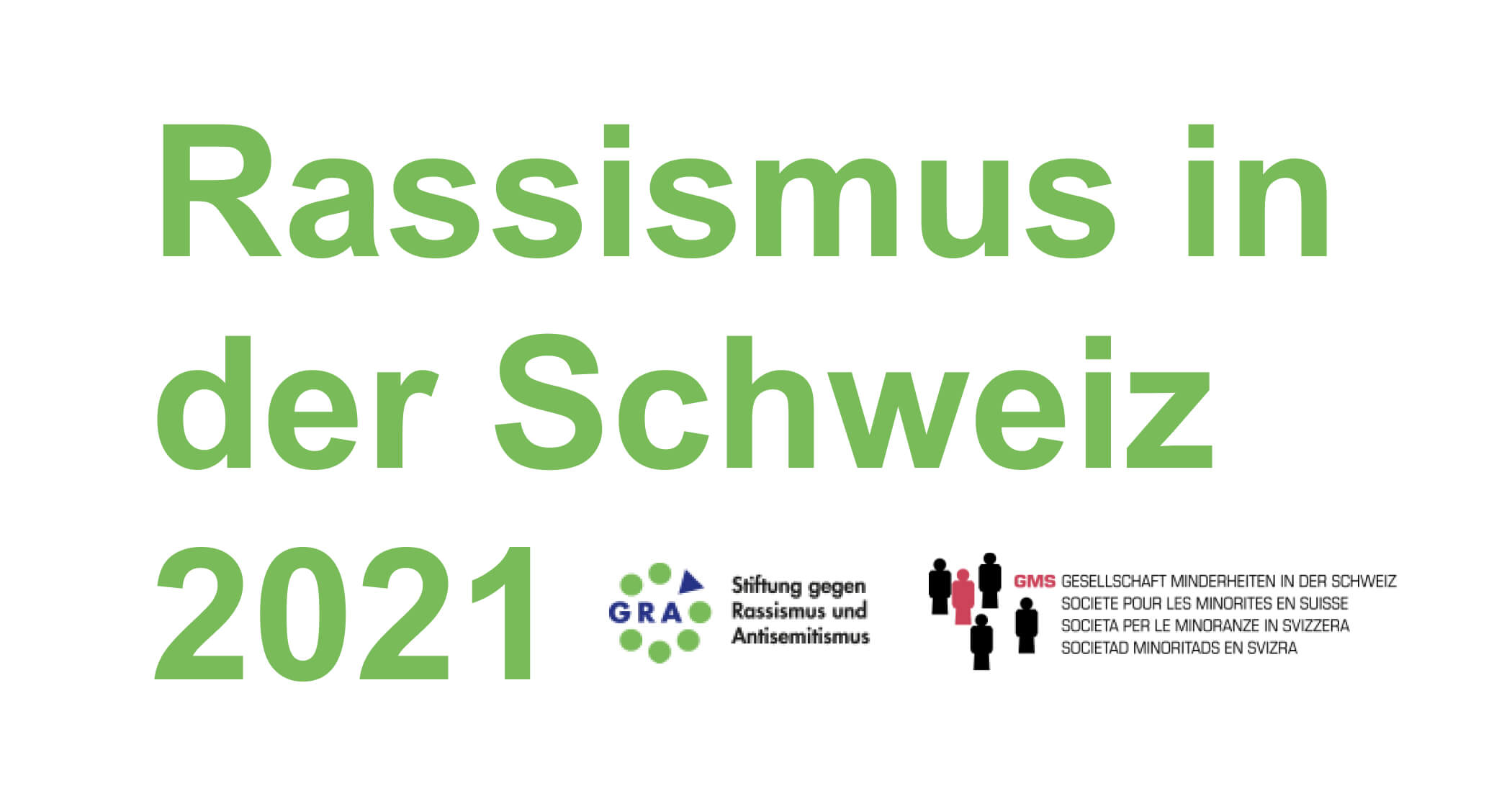
Rassismusbericht 2021 online!
Der neue Rassismusbericht der GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und der GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz thematisiert anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus rassistische Vorfälle des vergangenen Jahres. 2021 kam es zu besonders vielen Sachbeschädigungen und Sprayereien mit nationalsozialistischen Symbolen im öffentlichen Raum. Auch im Zusammenhang mit Protesten gegen die Coronamassnahmen tauchten vermehrt Hakenkreuze oder gelbe Davidsterne auf, welche einen Vergleich zwischen der aktuellen politischen Situation und dem nationalsozialistischen Regime zu ziehen versuchen.
Podcast: Antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus
2021 wurde die Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes 20 Jahre alt. Es ist der Moment für eine Zwischenbilanz: Wo steht die Rassismusbekämpfung heute? Und wie soll sie sich weiterentwickeln? Darüber diskutieren in der 9. Folge die GRA Geschäftsleiterin Dina Wyler und die Erziehungswissenschaftlerin Asmaa Dehbi.
Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus haben nur bedingt etwas mit Religion zu tun. Vielmehr sind sie Ausdrücke von Vorstellungen über das „Andere“. Während sich der antimuslimische Rassismus erneut durch Narrative um das Verhüllungsverbot zeigte, nahm der Antisemitismus in der Krise um Covid-19 stark zu. Asmaa Dehbi, Erziehungswissenschaftlerin und Forschende am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft der Universität Fribourg, und Dina Wyler, Geschäftsleiterin der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, erklären, nach welchen Mustern religionsbasierter Rassismus funktioniert, im Gespräch mit Christoph Keller.

Lesung und Gespräch zu «Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen.»
Am 8. Mai 2025 sprechen Judith Coffey und Vivien Laumann im Zollhaus Zürich über ihr Buch «Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen».
Im Buch loten die Autorinnen das Verhältnis von Jüdischsein und weiss-Sein aus und gehen der spezifischen Unsichtbarkeit von Juden:Jüdinnen in der Mehrheitsgesellschaft nach. In Anlehnung an das Konzept der Heteronormativität erlaubt «Gojnormativität», Dominanzverhältnisse in der Gesellschaft zu befragen und so ein anderes Sprechen über Antisemitismus zu etablieren.
Das Buch ist eine Aufforderung zu einem bedingungslosen Einbeziehen von Juden:Jüdinnen in intersektionale Diskurse und Politiken und zugleich ein engagiertes Plädoyer für solidarische Bündnisse und Allianzen.
Wann: 8. Mai 2025 um 19:00 Uhr
Wo: Zollhaus Zürich / online mit Livestream
Sprache: Deutsch und Verdolmetschung in Gebärdensprache (auf Anfrage)
Moderation: Prof. Dr. Amir Dziri
In Kooperation mit: ZIID und feministisch*komplex
>>Tickets kaufen: ZIID Zürcher Institut für interreligiösen Dialog
>>Flyer herunterladen
