Neues der GRA

Lesung und Gespräch zu «Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen.»
Am 8. Mai 2025 sprechen Judith Coffey und Vivien Laumann im Zollhaus Zürich über ihr Buch «Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen».
Im Buch loten die Autorinnen das Verhältnis von Jüdischsein und weiss-Sein aus und gehen der spezifischen Unsichtbarkeit von Juden:Jüdinnen in der Mehrheitsgesellschaft nach. In Anlehnung an das Konzept der Heteronormativität erlaubt «Gojnormativität», Dominanzverhältnisse in der Gesellschaft zu befragen und so ein anderes Sprechen über Antisemitismus zu etablieren.
Das Buch ist eine Aufforderung zu einem bedingungslosen Einbeziehen von Juden:Jüdinnen in intersektionale Diskurse und Politiken und zugleich ein engagiertes Plädoyer für solidarische Bündnisse und Allianzen.
Wann: 8. Mai 2025 um 19:00 Uhr
Wo: Zollhaus Zürich / online mit Livestream
Sprache: Deutsch und Verdolmetschung in Gebärdensprache (auf Anfrage)
Moderation: Prof. Dr. Amir Dziri
In Kooperation mit: ZIID und feministisch*komplex
>>Tickets kaufen: ZIID Zürcher Institut für interreligiösen Dialog
>>Flyer herunterladen

Medienmitteilung: Parlament schafft doch keine Gerechtigkeit
Die unabhängige Kommission für historisch belastetes Kulturerbe wurde heute vom Nationalrat beschlossen. Die GRA kritisiert, dass sie nur in Ausnahmefällen einseitig angerufen werden kann. Somit muss auch die Besitzpartei einverstanden sein mit einer Anrufung. Damit verpasst das Parlament, eine faire Lösung für die Aufarbeitung von historisch belasteten Kunstgütern zu erarbeiten.
Unsere Medienmitteilung dazu lesen Sie hier.
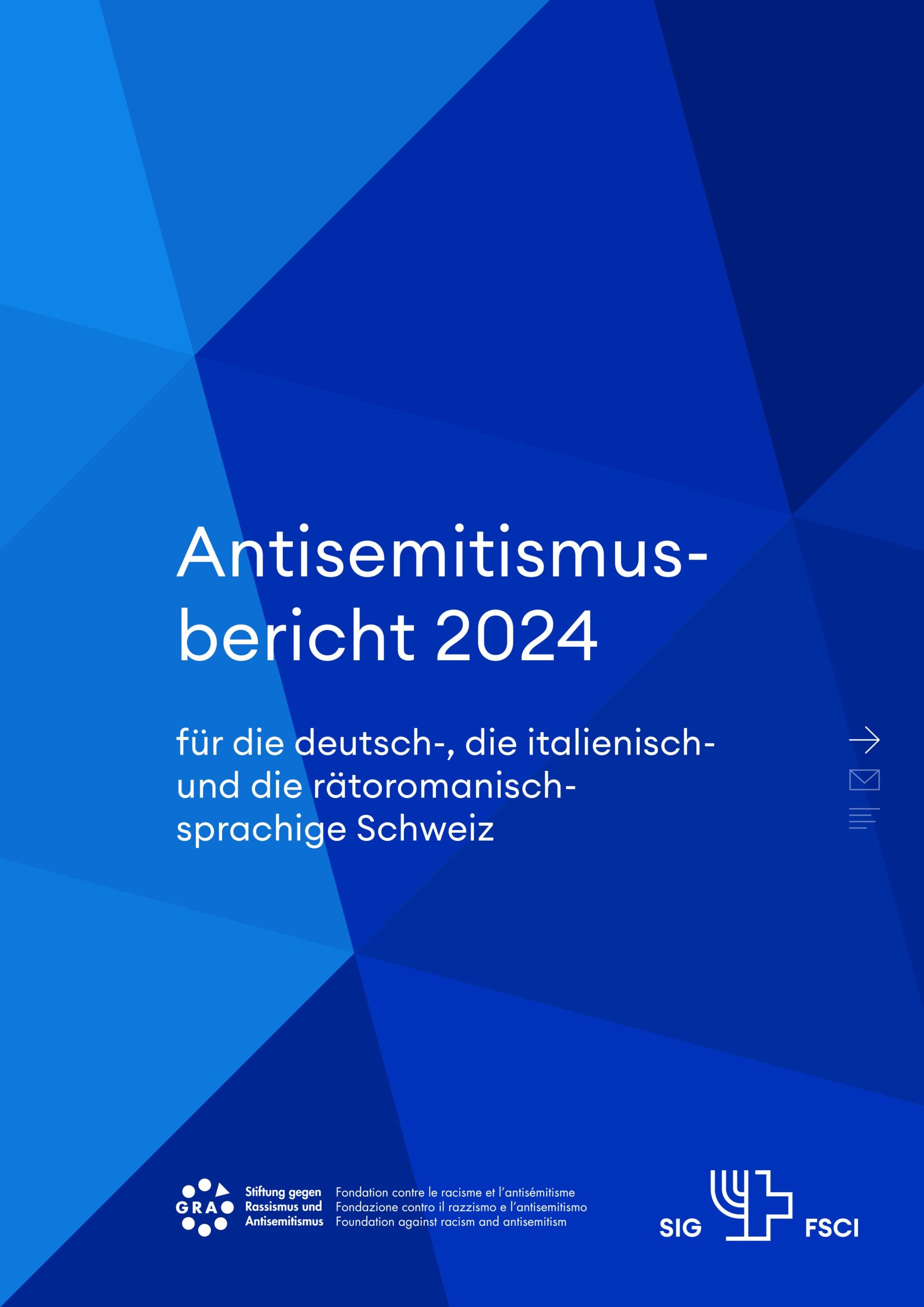
Antisemitismusbericht 2024
Der Antisemitismusbericht 2024 der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) und des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) dokumentiert das beispiellos hohe Niveau der Menge antisemitischer Vorfälle nach dem Höhepunkt von Ende 2023. Der Nahostkrieg bleibt der Haupttreiber für antisemitische Vorfälle. Jüdinnen und Juden erleben Antisemitismus direkter und unverhohlener als zuvor. Viele jüdische Menschen legen daher ein Vermeidungsverhalten an den Tag. Sie vermeiden, in der Öffentlichkeit als jüdisch erkannt zu werden.
Die 221 Vorfälle, die in der realen Welt gemessen wurden, entsprechen einer Steigerung von mehr als 40% gegenüber 2023 und fast einer Vervierfachung gegenüber 2022. Elf Tätlichkeiten im Berichtsjahr geben dem schweizerischen Antisemitismus eine gewalttätige Dimension. Besonders hervorzuheben sind die Messerattacke auf einen sichtbar jüdischen Zürcher Mann in Selnau im März sowie ein versuchter Brandanschlag auf eine Zürcher Synagoge im August. Der Bericht dokumentiert mithilfe einer neuen Suchmethode mehr als 1’500 Vorfälle von antisemitischer online Hate Speech.
Viele der Vorfälle beziehen sich auf den Krieg im Nahen Osten. Jüdinnen und Juden werden öfter für die Politik Israels verantwortlich gemacht, angegriffen und müssen sich rechtfertigen. Als Täter gelten vor allem Rechtsextreme, Linksextreme, Islamisten, verschwörungsaffine Gruppen und das radikal pro-palästinensische Lager.
Antisemitismus ist jedoch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Behörden müssen die Sicherheit jüdischen Lebens in der Schweiz gewährleisten. Die Umsetzung der Strategie und des Aktionsplans gegen Rassismus und Antisemitismus auf Bundesebene muss zügig vorangehen. Die Schweiz braucht eine strengere Regulierung von Online-Hassrede und Druck auf Social-Media-Plattformen.
Dokumente:

Medienmitteilung: Ständerat verhindert gerechte Aufarbeitung für NS-Fluchtopfer
Der Ständerat hat heute entschieden, dass die geplante Expertenkommission für historisch belastetes Kulturerbe nur zweiseitig angerufen werden kann. Der Modus einer zweiseitigen Anrufung verhindert, dass Geschädigte die Kommission ohne das Einverständnis des aktuellen Besitzers eines Werks anrufen können. Dies widerspricht diametral den Grundsätzen der schweizerischen Schiedsgerichtsbarkeit.
Die GRA bedauert, dass der Ständerat der Entscheidung des Nationalrats nicht folgt, der eine einseitige Anrufung der Kommission befürwortet hatte. Die historische Aufarbeitung wird künftig weiterhin erschwert.
Unsere Medienmitteilung dazu lesen Sie hier.
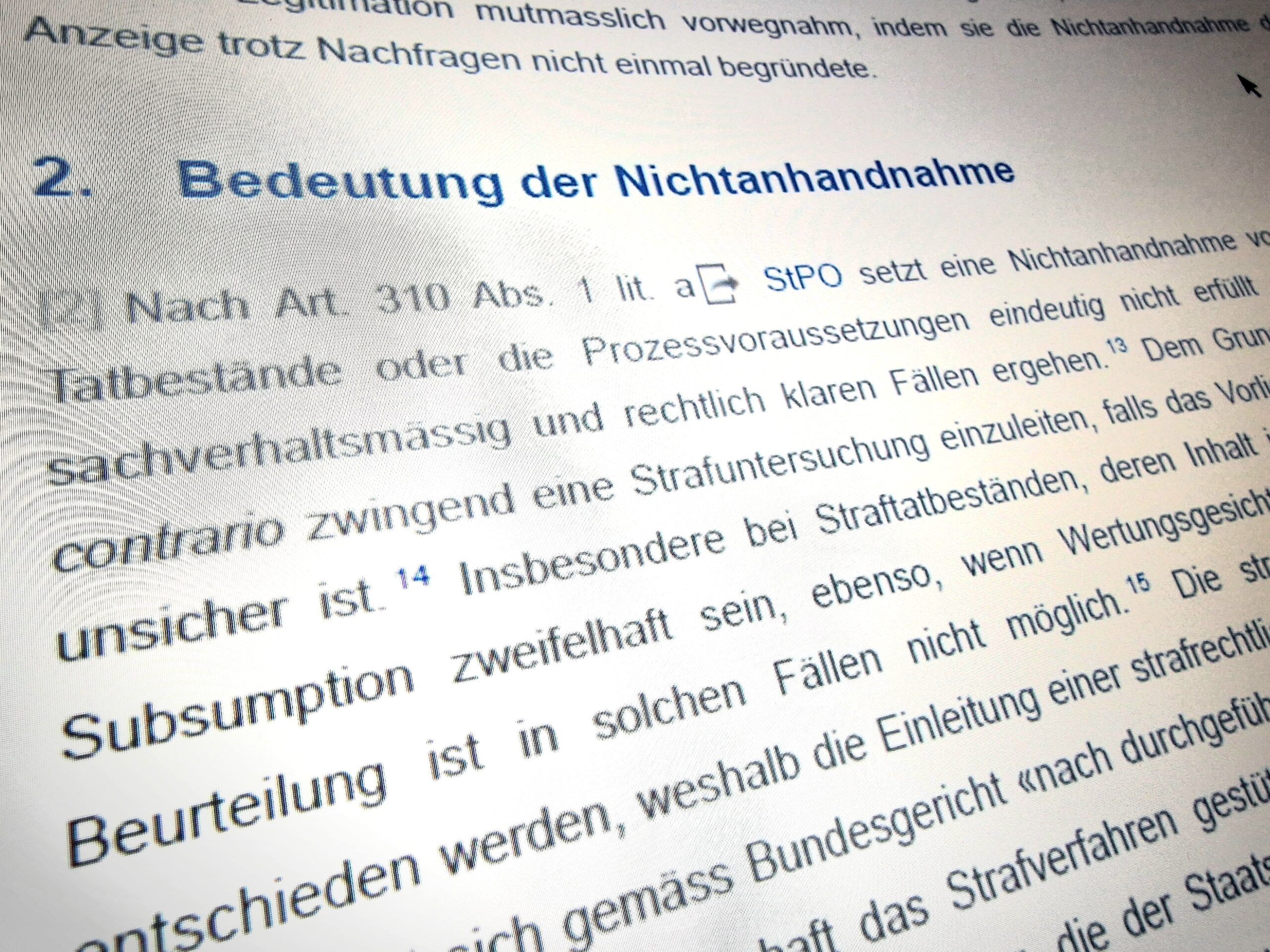
Wann wandelt sich Aktivismus in Hate Speech?
Wo endet die Meinungsfreiheit und wo wandelt sich Aktivismus in Hate Speech? In der schweizerischen Rechtspraxis nirgends, wenn man politische Parolen zum Nahostkonflikt betrachtet. Um diesem Sachverhalt nachzugehen, hat die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus die ehemalige Bundesrichterin und Stiftungsrätin Dr. Vera Rottenberg sowie Mia Mengel, wissenschaftliche Mitarbeiterin der GRA, mit einer rechtlichen Analyse beauftragt.
Im Mittelpunkt der Analyse «From the River to the Sea…», «Intifada bis zum Sieg» – keinesfalls strafbar? stehen ebendiese Slogans. Sie wurden nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verstärkt in der Schweizer Öffentlichkeit verwendet.
Die beiden Autorinnen argumentieren, dass eine strafrechtliche Relevanz der Parolen – insbesondere im Hinblick auf die Diskriminierungs-Strafnorm Art. 261bis StGB – nicht ausgeschlossen werden könne.

Fischhof-Preis prämiert zwei Politiker:innen und eine Aktivistin
Bei der diesjährigen Verleihung des Fischhof-Preises wurden erstmals drei Persönlichkeiten gleichzeitig für ihren Einsatz gegen Rassismus und Antisemitismus ausgezeichnet. Die Preisträger:innen sind alt SP-Nationalrat Angelo Barrile, Mitte-Ständerätin Marianne Binder-Keller und Theologin Nicola Neider Ammann. Im Gespräch mit Moderator David Karasek reflektierten sie über ihre Arbeit, ihre Motivation sowie ihre Sorgen und Ängste – doch auch über ihre Hoffnungen, die trotz aller Herausforderungen spürbar waren.
Alt Bundesrat Moritz Leuenberger sprach ebenfalls mit David Karasek und fragte selbstkritisch: «Bin ich vielleicht selbst antisemitisch, ohne es zu merken?» Er machte darauf aufmerksam, wie tief Rassismus und Antisemitismus in der Gesellschaft verankert sind und wie selten diese Mechanismen hinterfragt werden. Bewegende Laudationen von SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf, alt SIG-Präsident Herbert Winter und alt Grünen-Nationalrätin Cécile Bühlmann würdigten die Leistungen der Preisträger:innen eindrücklich.
Der Fischhof-Preis setzt auch 2024 ein starkes Zeichen gegen Diskriminierungen aller Art und bietet ein Gegennarrativ zu den Stimmen, die behaupten, das «Böse» sei unaufhaltsam. Die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und die GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz vergeben den Fischhof-Preis, um denjenigen Personen eine Bühne zu geben, die sich für Gerechtigkeit, Demokratie und Inklusion einsetzen.
Eine fotografische Rückschau finden Sie hier.
Foto: Alain Picard

Veranstaltungshinweis: «Bist du sicher? Ein Jahr 7. Oktober: Stimmen der Resilienz und Zerrissenheit»
Besuchen Sie die Veranstaltung von feministisch*komplex mit Unterstützung von Tsüri.ch, Maison du Futur und der GRA unter dem Titel «Bist du sicher? Ein Jahr 7. Oktober: Stimmen der Resilienz und Zerrissenheit».
Kommenden Sonntag diskutiert GRA-Geschäftsleiter Philip Bessermann mit Laura Cazés (Herausgeberin von Sicher sind wir nicht geblieben), Do Graff (feministisch*komplex) und Anna Jikhareva (Wochenzeitung) unter der Gesprächsleitung von Simon Jacoby (Tsüri.ch).
Wann? 6. Oktober 2024 ab 16:30 Uhr
Wo? C.F.Meyer-Haus, Alte Landstrasse 170, 8802 Kilchberg
Programm? Moderierte Diskussion und Konzert von Chaibe Balagan
Es sind noch wenige Tickets vorhanden, die Sie hier erwerben können.
In den Worten von feministisch*komplex: «Unsere zweite Veranstaltung lädt euch dazu ein, in einem geschützten Rahmen Solidarität zu erleben und über unsere Verletzungen zu sprechen. Wir möchten einen Raum schaffen, der nicht für Kontroversen gedacht ist, sondern für Reflexion und Verarbeitung – besonders aus feministischer, jüdischer und queerer Perspektive.»
Wer möchte, kommt bereits um 14:45 Uhr zum Bürkliplatz für eine gemeinsame Schifffahrt nach Kilchberg, Abfahrt um 15 Uhr.

Ringvorlesung «Antisemitismus» der Sigi Feigel-Gastprofessur für Jüdische Studien
Wann: Jeweils montags zwischen 18.15 bis 19.45 Uhr
Daten: 23.09./14.10./28.10/04.11/18.11./2.12./16.12.
Ort: Universität Zürich, Rämistrasse 71, Raum: KOH-B-10
Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat der Begriff des Antisemitismus in öffentlichen Debatten wieder hörbar Eingang gefunden. Doch wird nicht nur mit Blick auf dieses Ereignis und seine Folgen über Antisemitismus diskutiert. Jüdische Menschen in der ganzen Welt sind seit dem Herbst 2023 vermehrt antisemitischen Anfeindungen in allen Formen ausgesetzt. Während Jüdinnen und Juden auf diese Weise unmittelbar von Antisemitismus betroffen sind, werden andere im öffentlichen Diskurs wiederum als antisemitisch bezeichnet, wenn sie beispielsweise eine «israelkritische» Stellung zur Lage in Nahost beziehen.
Antisemitismus ist kein neues Phänomen. Der Hass gegen jüdische Menschen blickt auf eine lange (Leidens-)Geschichte zurück, die nun wieder aktuell geworden ist. Die Ringvorlesung analysiert Begriff, Geschichte und Ausdrucksformen des Antisemitismus und lässt Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft zu Wort kommen, die historische Hintergründe, psychologische und rechtliche Dimensionen, ideologische und politische Erscheinungen sowie persönliche Erfahrungen vorstellen.
Die Ringvorlesung wird in Kooperation mit der Gamaraal Foundation veranstaltet (www.last-swiss-holocaust-survivors.ch).
Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen finden Sie im Veranstaltungsflyer.
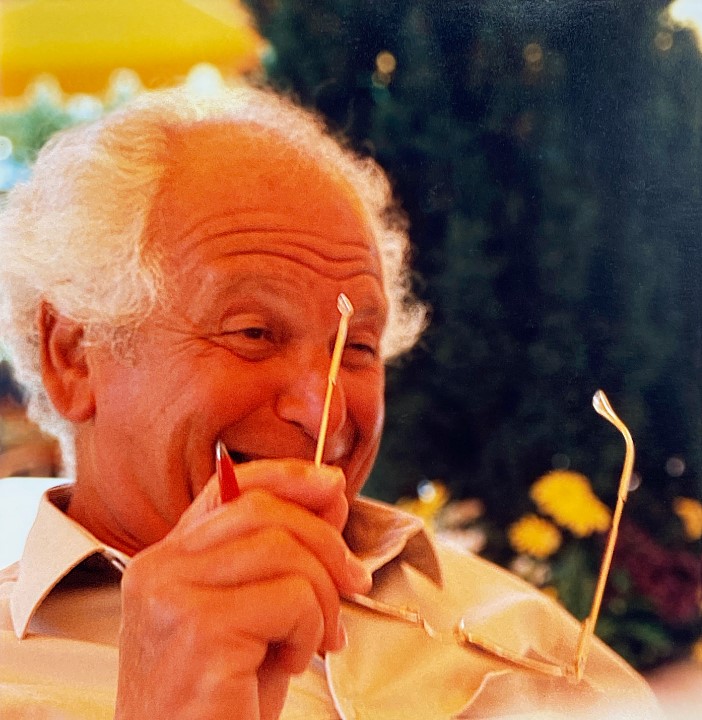
Die Stiftung GRA würdigte ihren Gründer Sigi Feigel
Der Name Sigi Feigel klingt bei jüngeren Generationen nicht mehr gleich an – sollte es aber heute umso mehr. Sein wirkungsvolles Schaffen reicht bis in unsere Zeit und ist noch immer hochaktuell. Am 28. August 2004, also genau vor zwanzig Jahren, verstarb der Mann, der unter anderem wesentlich zur Annahme der Rassismus-Strafnorm beitrug. Seinem vieljährigen Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus wurde gestern an seinem Todestag gemeinsam mit vielen ehemaligen Mitstreiter:innen wie Alt-Parlamentarier:innen Markus Notter (SP), Cécile Bühlmann (Grüne) und Paul Rechsteiner (SP), Alt-Stadtpräsident Josef Estermann (SP) sowie Publizist Roger de Weck in Zürich-Enge gedacht. Der Moderator David Karasek (SRF) führte durch den würdigen Abend – Anne Battegay, François Robin und Alessandro Tardino begleiteten diesen musikalisch exzellent.
Im Zuge des Anlasses und mit zugänglichen Worten von Dr. Zsolt Balkanyi-Guery, Jacques Lande, Michael Richter, Dr. Klara Obermüller und Ronnie Bernheim wurde nicht nur Sigi Feigel wieder lebendig, sondern es wurde auch klar, dass die Grundsteine für ein wirkungsvolles Arbeiten gegen Antisemitismus und Rassismus eigentlich vorhanden sind. Was die Gesellschaft allerdings weiterhin unbedingt braucht, sind Menschen, die wie Sigi, nicht aufhören, sich für sie einzusetzen.
Weiterführende Informationen finden Sie in der Medienmitteilung.
Hochauflösende Bilder zur freien Benutzung unter Berücksichtigung der Copyright-Angabe © Alain Picard.
- Podiumsgespräch zwischen Moderator David Karasek, Dr. Klara Obermüller und Ronnie Bernheim
- Ronnie Bernheim und Dr. Klara Obermüller im Gespräch
- Ansprache Dr. Zsolt Balkanyi-Guery
- Ansprache Jacques Lande
- Ansprache Michael Richter
- Musiker:innen Anne Battegay, François Robin und Alessandro Tardino
- Moderator David Karasek stehend
- Moderator David Karasek sitzend
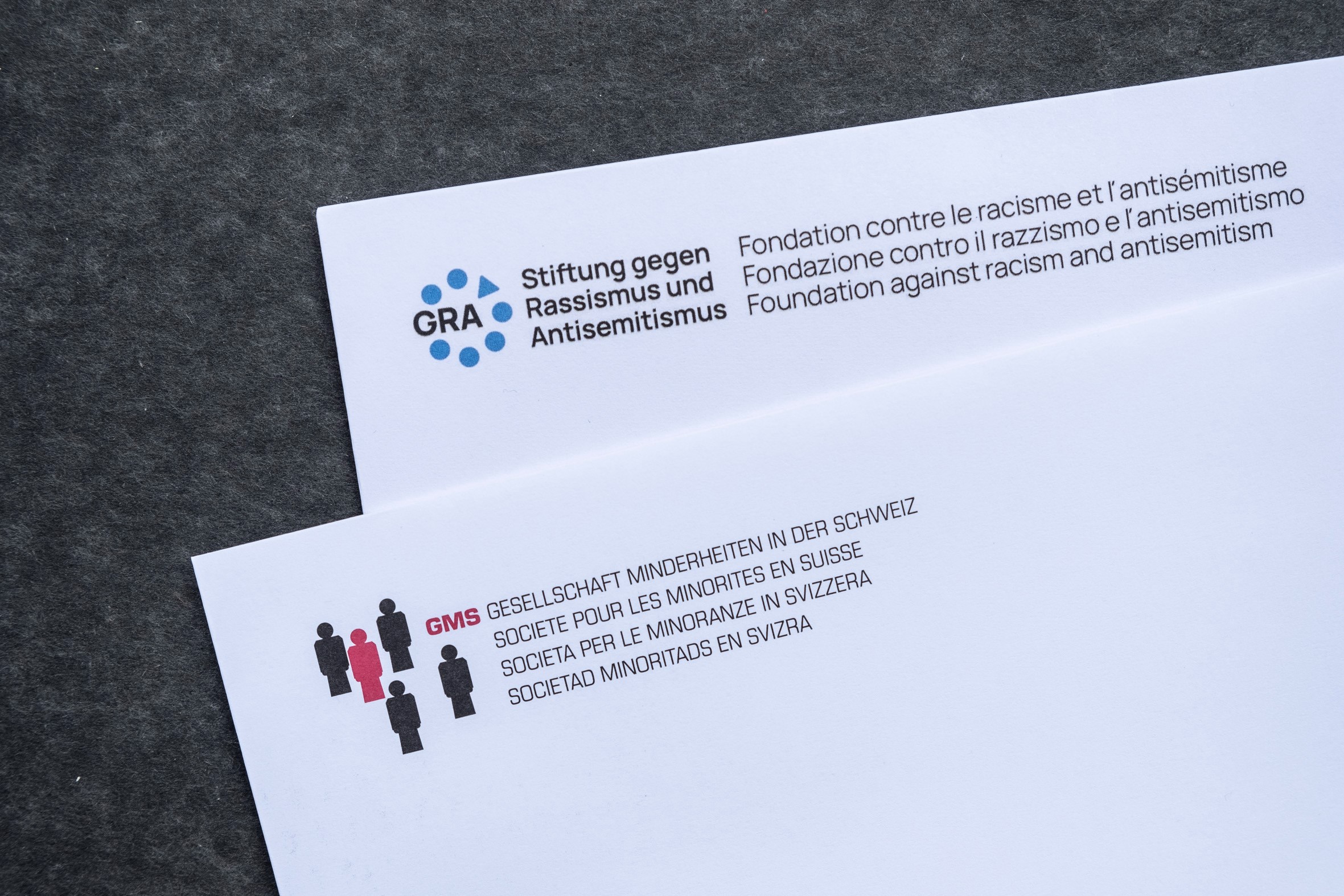
Drei Preisträger:innen erhalten den Fischhof-Preis 2024
Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) und die Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz (GMS), unterstützt vom Sigi und Evi Feigel-Fonds, ehren mit der Verleihung des Nanny und Erich-Fischhofpreises drei Persönlichkeiten, die sich kontinuierlich gegen Diskriminierung und für den Schutz von Minderheiten einsetzen.
Die Preisträger:innen der diesjährigen Preisverleihung:
Mitte-Ständerätin Marianne Binder-Keller setzt sich seit Jahren auf der politischen Ebene gegen Antisemitismus und zum Wohl der jüdischen Gemeinschaft ein. Geprägt wurde sie durch das geistige Erbe ihrer Grossmutter Paulina Borner, die im Zweiten Weltkrieg jüdischen Geflüchteten in der «Rosenlaube» in Baden Schutz bot. Ihre Mutter, die Schriftstellerin Rosemarie Keller, schrieb darüber ihren prägenden Roman «Die Wirtin». Binder war massgeblich daran beteiligt, das Verbot von Nazi-Symbolen politisch durchzusetzen. In der schweizerischen Aussenpolitik steht sie für die Einhaltung der Menschenrechte.
Alt-SP-Nationalrat Angelo Barrile kämpfte unermüdlich für Gleichheit und Inklusion in der Gesellschaft. Während seiner Amtszeit initiierte er eine parlamentarische Initiative zum Verbot der öffentlichen Verwendung von extremistischen Symbolen und setzte sich auch für die Entwicklung eines nationalen Aktionsplans gegen LGBTQ-feindliche Hassverbrechen ein. Vehement kämpfte er dafür, dass die Rassismus-Strafnorm um die sexuelle Orientierung erweitert wurde.
Nicola Neider Ammann ist Theologin und Leiterin des Bereichs Migration und Integration der katholischen Kirche Stadt Luzern. Sie verlor im Holocaust jüdische Verwandte väterlicherseits. Heute bietet sie Zugewanderten, darunter Geflüchteten, Migrant:innen und Sans-Papiers tagtäglich Schutz und Unterstützung. Zudem setzt sie sich auf zivilgesellschaftlich-politischer Ebene für deren Integration ein. Sie wirkte an der Migrationscharta mit, unterstützte das No-Frontex-Bündnis und engagiert sich seit der Gründung als Präsidentin der Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern.
Der Nanny und Erich Fischhof-Preis in Höhe von CHF 50’000.- wird an Persönlichkeiten oder Institutionen verliehen, die sich in der Bekämpfung von Rassismus im Allgemeinen und Antisemitismus im Besonderen in der Schweiz verdient gemacht haben. Das Preisgeld wird paritätisch unter den Nominierten aufgeteilt.
Die Preisverleihung findet im November 2024 in Zürich statt.

Medienmitteilung: Ständerat verabschiedet nationale Strategie und Aktionsplan
Der Ständerat hat die Dringlichkeit erkannt, systematisch, strategisch und koordiniert gegen Diskriminierung vorzugehen. Er verabschiedete entsprechend heute eine nationale Strategie und einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus.
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider bestätigt die Dringlichkeit: «Der Angriff auf einen jüdischen Mann in Zürich, antisemitische Vorfälle in Schulen und Angriffe auf muslimische Mitbürger:innen sowie jüdische und muslimische Institutionen sind leider nur die Spitze des Eisbergs.» und fügt an: «Wir sind Zeugen einer zunehmend polarisierten Debatte, die den Dialog erschwert und die soziale Kohäsion gefährdet.» (aus dem Französischen übersetzt)
Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) begrüsst die Annahme.
Weiterführende Informationen finden Sie in der Medienmitteilung.
Bild: VBS/DDPS – Nicola Pitaro – NC – ND
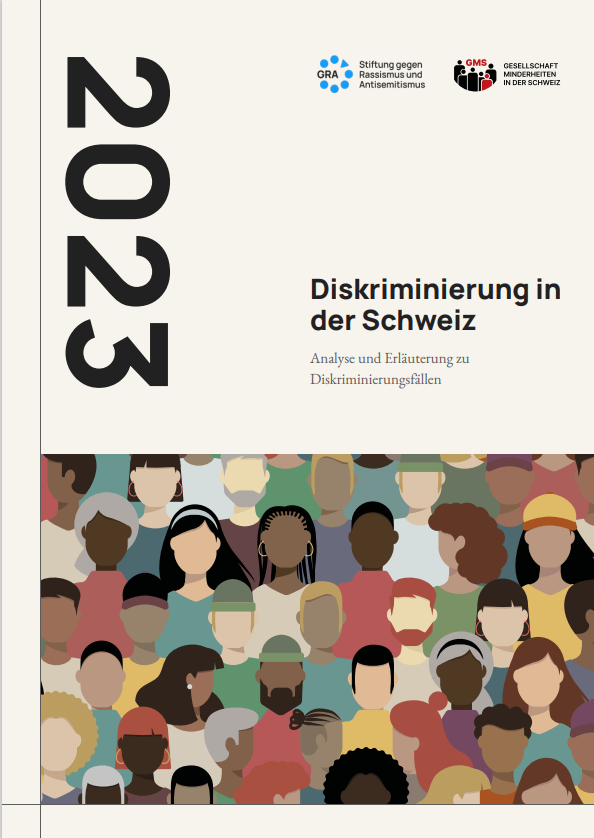
Diskriminierungsbericht 2023
Der neuste Bericht der GRA und GMS zum Jahr 2023 ist da.
Aufgrund der Ausweitung der Diskriminierungsstrafnorm Art. 261bis des Strafgesetzbuches (StGB) in den letzten Jahrzehnten, auch im Hinblick auf Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung, wurde der Bericht umbenannt und heisst nunmehr „Diskriminierungsbericht“ anstelle von „Rassismusbericht“.
Die umfassende Analyse der jährlichen Diskriminierungsfälle in der Schweiz 2023 zeigt einen sprunghaften Anstieg der antisemitischen Vorfälle nach dem Angriff der Hamas und dem nachfolgenden Krieg in Gaza. Damit einher geht eine zunehmende Sichtbarkeit von allgemein diskriminierenden Taten und Hassreden. Die insgesamt 98 registrierten Vorfälle im Jahr 2023 stellen eine Zunahme um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr dar.
Was für Schlüsse daraus zu ziehen sind und welche Konzepte im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus helfen können sind im vollständigen Bericht inklusive Interview mit Hannan Salamat vom Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (ZIID) und der dazugehörigen Medienmitteilung zu finden.
Medienmitteilung Diskriminierungsbericht 2023

Lesung und Gespräch zu «Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen.»
Am 8. Mai 2025 sprechen Judith Coffey und Vivien Laumann im Zollhaus Zürich über ihr Buch «Gojnormativität. Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen».
Im Buch loten die Autorinnen das Verhältnis von Jüdischsein und weiss-Sein aus und gehen der spezifischen Unsichtbarkeit von Juden:Jüdinnen in der Mehrheitsgesellschaft nach. In Anlehnung an das Konzept der Heteronormativität erlaubt «Gojnormativität», Dominanzverhältnisse in der Gesellschaft zu befragen und so ein anderes Sprechen über Antisemitismus zu etablieren.
Das Buch ist eine Aufforderung zu einem bedingungslosen Einbeziehen von Juden:Jüdinnen in intersektionale Diskurse und Politiken und zugleich ein engagiertes Plädoyer für solidarische Bündnisse und Allianzen.
Wann: 8. Mai 2025 um 19:00 Uhr
Wo: Zollhaus Zürich / online mit Livestream
Sprache: Deutsch und Verdolmetschung in Gebärdensprache (auf Anfrage)
Moderation: Prof. Dr. Amir Dziri
In Kooperation mit: ZIID und feministisch*komplex
>>Tickets kaufen: ZIID Zürcher Institut für interreligiösen Dialog
>>Flyer herunterladen
